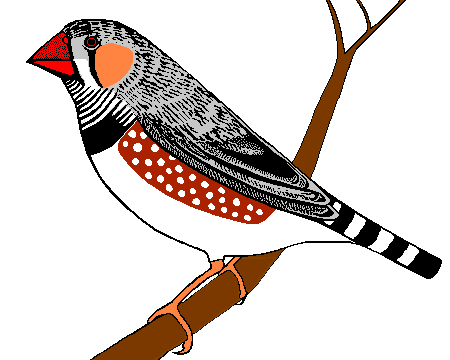
Daß Prachtfinken zwar meist "prächtig", aber keine "Finken" sind, wissen die meisten Vogelliebhaber. Aber was diese Vogelfamilie auszeichnet und von anderen Familien unterscheidet, wo sie im taxonomischen System der Vögel einzuordnen sind und welches ihr Verhältnis etwa zu den Finken ist, davon haben viele nur vage Vorstellungen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, daß sich auch Ornithologen in solchen Fragen schwer einigen können.
Verwandtschaften
Zusammen mit den uns gut bekannten Rabenvögeln, Würgern, Sängern (Drosseln, Scnäppern, Schmätzern), Schwalben, Meisen, Grasmücken, Lerchen, Stelzen, Braunellen, Sperlingen, Edelfinken (Buch- und Bergfinken), Gimpeln (Dompfaffen und Hänflingen, Kernbeißern, Kreuzschnäbeln, Grünlingen etc.) und Ammern gehören auch viele exotische Vogelfamilien in die große Unterordnung der "Singvögel" innerhalb der Ordnung der "Sperlingsvögel": z. B. die Honigfresser, Paradiesvögel, Brillenvögel, Bülbüls, Prachtfinken, Witwen und Webervögel. Die einzelnen Familien stehen zwar als solche im System der Vögel "gleichberechtigt" nebeneinander, weisen aber untereinander durchaus unterschiedliche Verwandtschaftsgrade auf.
So sind die Prachtfinken (Estrildidae) mit den Witwen und Webern offenbar enger verwandt als mit den Sperlingen, eigentlichen Finken (Edelfinken) und Gimpeln. Die Prachtfinken wurden aufgrund ihrer Verwandtschaft mit den Webern (Ploceidae) diesen lange Zeit zugeordnet und als "Webefinken" bezeichnet: Weitere Unterfamilien innerhalb der Webervögel waren – und sind bei manchen Arten immer noch – die Witwen- und Sperlingsvögel. Auch der Laie kann das leicht an den Endungen erkennen: Familien enden in der wissenschaftlichen Terminologie auf -idae, Unterfamilien aber auf -inae.
Eine egere Verwandtschaft mit den Finken, d. h. Fringilliden und Cardueliden, wurde und wird hingegen nicht angenommen. Daß wir Europäer und namentlich die Engländer die Prachtfinken als "Finken", "vinken" bzw. "finches" bezeichnen, ist dennoch verständlich: Die frühen Eroberer und Siedler benannten die Vögel in ihren Kolonien zunächst einfach nach den europäischen Arten, die ihnen äußerlich am ähnlichsten waren.
Charakteristische Merkmale
Die Wissenschaft der Klassifikation der Tierarten (Taxonomie) tut sich, wie gesagt, schwer, endgültige Aussagen über die Stellung eines Tieres und seine Verwandtschaften zu treffen; die früher oft einseitigen und subjektiven Untersuchungsmethoden machten immer wieder Neubewertungen nötig. Speziell die Biochemie hat aber in letzter Zeit mit der Untersuchung der Eiweißkörper (Elektrophorese) z. B. im Eiklar große Fortschritte ermöglicht. Dennoch sind weiterhin auch körperliche und Verhaltensmerkmale als taxonomische Kriterien durchaus nützlich:
So besitzen etwa die Finken nur neun Handschwingen, die Prachtfinken hingegen zehn. Die Männchen der Webervögel weben vor der Balz gleich mehrere kunstvolle Kugelnester, und viele Arten sind polygam; Prachtfinken verhalten sich da ganz anders. In seinem Standardwerk Estrildid Finches of the World gibt GOODWIN eine ausgezeichnete Zusammenfassung der charakteristischen Prachtfinkenmerkmale, die deshalb hier in deutscher Übersetzung zitiert sei:
"Die Estrildiden sind durch die folgenden Verhaltensmuster charakterisiert, vob denen einige sie scharf gegen Finken, Ammern und Weber abgrenzen:
Nicht jede Prachtfinkenart zeigt alle der oben aufgelisteten Verhaltensmuster, aber doch die meisten Arten (deren Verhalten bekannt ist), und alle zeigen die meisten der Verhaltensweisen. Alle Estrildiden legen, soweit bekannt, unmarkierte weiße Eier (die leicht rosafarben erscheinen können, wenn sie frisch sind, und seltsam dunkel oder sogar bläulich kurz vor dem Schlüpfen der Jungen, vermutlich weil der Inhalt sich teilweise durch die Schale zeigt oder die Reflexion des Lichtes beeinflußt). Ihre Nestlinge haben auffällige Schnabelrandwülste oder Papillen und gewöhnlich auffallende Flecken und/oder Linienmuster auf den Schnabelinnenseiten. Bei einigen Arten wird das Gaumenmuster von den Erwachsenen beibehalten und spielt vielleicht beim Nibbelverhalten eine Rolle. Kontaktsitzen und Gefiederkraulen zwischen dem Männchen und Weibchen eines Paares und manchmal auch unter Schwarmmitgliedern sind häufige Gewohnheiten bei vielen, aber nicht allen Arten."
Weitere Merkmale
Man kann diese Angaben noch um einige weniger charakteristische Merkmale ergänzen: Prachtfinken erreichen mit den größten Arten gerade Buchfinkengröße, es gibt aber auch (speziell in Afrika) viele kleine Arten, die sogar noch die Größe unserer Goldhähnchen unterschreiten. Die Schnabelform reicht von kräftig mit breiter Basis bis zu lang und dünn, wie sie für Insektenfresser typisch ist. Die meisten Prachtfinken sind überwiegend Körnerfresser, namentlich die afrikanischen Arten (= Astrilde) erbeuten aber auch außerhalb der Brutzeit Insekten, und manche nehmen auch Früchte.
Die Nester werden ganz überwiegend über dem Boden in (dornigem) Gebüsch und Bäumen frei angelegt, teilweise auch in Höhlungen. Bei der Nistplatzsuche spielt das Männchen die aktivere Rolle, es sucht einen möglichen Standort und schlägt ihn – oft mit speziellen Nestlockrufen – dem Weibchen vor, das dann über die Annahme entscheidet. Ein bevorzugtes Polstermaterial sind weiße Federn, für die Prachtfinken weit fliegen. Die vier bis sechs Eier werden ab dem dritten oder vierten Ei bebrütet, die Partner lösen einander tagsüber ungefähr im 1,5-Stunden-Rhythmus ab, nachts brütet das Weibchen, auch wenn der Partner ebenfalls im Nest schläft. Fast alle Arten hudern bis zum 10. Lebenstag, dann nur noch nachts. Die Brutdauer schwankt zwischen 11 und 14 tagen, die Nestlingszeit zwischen 16 bis 18 und 21 bis 28 Tagen (Reisamadine)
Brutwirte
In Afrika sind einige Arten Zieheltern harmloser Brutschmarotzer, der Witwenvögel (Viduidae), die ihren Brutwirten jeweils ein Ei zum Ausbrüten ins Nest legen, wo die junge Witwe dank fast perfekter Übereinstimmungen in Gestalt und Verhalten unbemerkt mit den Prachtfinken-Nestlingen heranwächst. Faß man die Ähnlichkeiten nur als verblüffende Anpassungsleistungen an die Wirtsart auf, so spricht das gegen eine enge Verwandtschaft zwischen beiden Familien.
Verbreitung und Wohnräume
Prachtfinken sind in 49 Gattungen und 132 Arten (nach WOLTERS) nur in den Tropen und Subtropen der Alten Welt verbreitet, und zwar von Afrika südlich der Sahara und Madagaskar bis nach Neuguinea, Australien und vielen Inseln Ozeaniens. Afrika, der vermutliche Ursprungskontinent dieser Vogelfamilie, weist die meisten und die unterschiedlichsten Arten auf. Eine Art, der Wellenastrild, wurde vom Menschen in Portugal eingebürgert. Natürlich findet man Prachtfinken innerhalb ihres Verbreitungsgebietes nicht überall: Zwar konnten einige Arten so verschiedene und gegensätzliche Lebensräume wie dichte Waldgebiete und sogar Halbwüsten besiedeln; die Landschafts- und Vegetationsformen zwischen diesen beiden Extremen, also Waldränder und lichte Trockenwälder, Schilfgürtel und busch- und baumbestandene Savannen und Steppen, stellen allerdings mit ihrer üppigeren Gräserflora die bevorzugten Habitate dar.
| © 15.09.1997 | Taxonomie |